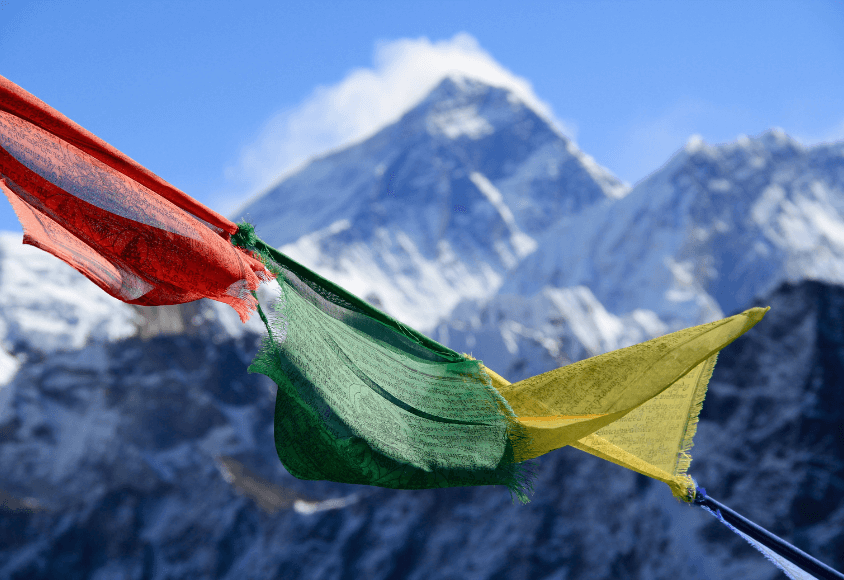Das desaströse Ende des Afghanistaneinsatzes im vergangenen August markiert einen gravierenden Einschnitt in der internationalen Friedens- und Sicherheitspolitik und hat der Frage nach den Lehren für solche Einsätze neuen Schub gegeben. Das Debakel des Westens überdeckt indes ein erfolgreiches Gegenbeispiel in der Region: Denn das Beispiel Nepals – das Land ist wie Afghanistan Mitglied der Südasiatischen Vereinigung für regionale Kooperation (SAARC) – zeigt auf, unter welchen mitunter unkonventionellen Bedingungen Friedensförderung von außen erfolgreich sein kann.
Zwar haben vier internationale Menschenrechtsorganisationen erst im November 2021 – pünktlich zum 15. Jahrestag des Friedensvertrags in Nepal – eine gemeinsame Erklärung veröffentlicht, die die fehlenden Fortschritte bei der Aufarbeitung der Kriegsverbrechen anprangert. Nepals Regierung solle endlich die Anliegen der Kriegsopfer in den Mittelpunkt ihrer Politik stellen und einen klaren Zeitplan für einen Prozess der Übergangsjustiz festlegen, um die Rechtsstaatlichkeit im Land nicht weiter zu untergraben.
Dessen ungeachtet gilt Nepal gerade unter europäischen Expert*innen und Politiker*innen nach wie vor als Liebling westlicher Geberinstitutionen und als „bemerkenswerter Erfolg“ internationaler Friedens- und Sicherheitspolitik. So hatte es Ian Martin, britischer Menschenrechtler und früherer Chef der Mission der Vereinten Nationen in Nepal (UNMIN), einst selbst formuliert.
Und in der Tat: Als im November 2006 der damalige Premierminister Girija Prasad Koirala und der Anführer der maoistischen Rebellengruppe Pushpa Kamal Dahal ihre Unterschrift unter einen Friedensvertrag setzten, beendeten sie so einen Bürgerkrieg, der in den zehn Jahren zuvor mehr als 13000 Tote gefordert und zu weitreichenden Menschenrechtsverletzungen geführt hatte, einschließlich der Ermordung, Vergewaltigung und Folter von Zivilist*innen.
Seitdem hat Nepal einen beeindruckenden Wandel vollzogen. Alle Wahlen in der Nachkriegszeit wurden von internationalen Beobachter*innen als vornehmlich frei und fair bewertet. Die Entwaffnung, Demobilisierung und Reintegration der Rebellengruppe begann schleppend, fand jedoch mit der Aufnahme von rund 1400 ehemaligen Kämpfer*innen in die staatliche Armee 2013 ein erfolgreiches Ende. Im September 2015 verabschiedete das Parlament in Kathmandu eine neue Verfassung – ein Meilenstein im Friedensprozess, auf den sich Politiker*innen neun Jahre lang nicht hatten einigen können. Gemeindewahlen im Frühjahr 2017 – die ersten seit 1997 – brachten die inklusivsten Lokalregierungen in der Geschichte des Landes hervor, mit vielen zivilgesellschaftlichen Aktivist*innen in neuen Ämtern. Diese Erfolge sollte man „in der ganzen Welt“ bekanntmachen, resümierte damals der deutsche Botschafter Roland Schäfer.
Maßgeschneiderte Einsätze statt internationaler Blaupausen
Unterstützt wurde dieser Prozess durch die internationale Gemeinschaft, darunter von 2007 bis 2011 durch den Einsatz der UN-Mission. Zwar hat eine internationale Unterstützung auch in anderen Postkonfliktstaaten wie Kambodscha oder Liberia dabei geholfen, eine Rückkehr in den Krieg zu verhindern. Allerdings konnte sie dort im Gegensatz zu Nepal keinen dauerhaften Frieden schaffen. Das Resultat sind Grauzonen „zwischen Krieg und Frieden“, in denen Gewalt für viele Menschen eine tägliche Erfahrung bleibt.
Die Friedens- und Konfliktforschung geht davon aus, dass ein Grund für diesen Misserfolg darin liegt, dass große internationale Einsätze zu oft auf Friedensförderung „von oben“ und auf Standardrezepte und Blaupausen für Staatsaufbau nach westlichem Vorbild setzen. Diese aber sind zu wenig an lokale Kontexte angepasst und können lokale Konfliktursachen nur unzureichend bekämpfen. Internationales Personal ist meist nur wenige Monate oder Jahre vor Ort, bevor es im nächsten Konfliktland zum Einsatz kommt, spricht nicht die lokalen Sprachen und kennt die Gegebenheiten und Kulturen zu schlecht,um Konflikte angemessen zu lösen. In Nepal wurde auf eine große, multidimensionale Friedens- und Staatsaufbaumission verzichtet, wie sie seit den 1990er-Jahren den Werkzeugkasten internationaler Friedensförderung in Ländern wie Kosovo oder Osttimor geprägt hat. UNMIN war als „Designer“-Mission mit vergleichsweise geringem Personaleinsatz angelegt. Das hatte sowohl regionale als auch lokale Ursachen: Zum einen hatten Indien und China wenig Interesse an einem großen Kontingent ausländischer Streitkräfte in ihrer Nachbarschaft, zum anderen waren sich auch Nepals Konfliktparteien in dieser Frage ungewohnt einig. Als der indische Journalist Siddharth Varadarajan Rebellenchef Dahal 2005 fragte, ob denn die internationale Überwachung des Friedensvertrags auch die Entsendung ausländischer Truppen beinhalten sollte, antwortete dieser entschieden: „No troops“. Seine militärischen Widersacher in der Armee sahen das ähnlich. Nepal zählt seit den 1990er-Jahren zu den bedeutendsten Truppenstellern von UN-Friedensmissionen – nepalesische Blauhelmsoldat*innen haben Friedenseinsätze in zahlreichen Ländern durchgeführt und dort Erfahrungen gesammelt. Als „demütigend“ beschreiben sie das Gefühl, hätten sie Truppen aus anderen Ländern akzeptieren müssen, um ihren eigenen Frieden zu fördern.
Vor diesem Hintergrund gründte die Resolution 1740 des UN-Sicherheitsrates am 10. Januar 2007 UNMIN formell nicht als Friedenssicherungseinsatz, sondern als politische Mission. Zu ihren Aufgaben zählten die Überwachung des Waffenstillstandes, die Unterstützung der Konfliktparteien in ihren Vereinbarungen zum Umgang mit Waffen und die Beobachtung der Wahlen zu einer verfassunggebenden Versammlung. Bei vollständiger Entsendung waren dabei lediglich 887 zivile Mitarbeiter*innen und 186 Militäroffiziere vor Ort. Letztere waren auf Wunsch der Konfliktparteien unbewaffnet, oft bereits im Ruhestand und in Zivil gekleidet. Viele zivile Mitarbeiter*innen hatten bereits für die bestehende UN-Präsenz im Land gearbeitet und brachten so mehr Kenntnisse und Verständnis für Nepal mit, als es in anderen, rasch etablierten Einsätzen üblich ist.
Ziele an Ausgangsbedingungen anpassen
Dieses Modell hatte Erfolg – auch, weil die Ziele des Einsatzes, wie etwa die Unterstützung bei der Durchführung und die Beobachtung der Wahlen, an die prinzipiell guten Ausgangsbedingungen vor Ort geknüpft waren. Internationale Interventionen finden meistens gerade an jenen Orten statt, in denen die Rahmenbedingungen für Frieden nicht gegeben sind. Das macht die Chancen auf große und nachhaltige Erfolge von Beginn an gering. Die Herausgeber*innen des Friedensgutachtens urteilten jüngst etwa, dass Afghanistan einer der härtesten Fälle für Friedensförderung war, so dass „ein nachhaltiger Erfolg, nicht das Scheitern internationaler Unterstützung eine Überraschung gewesen“ wäre.
Auch in Nepal war die Ausgangslage schwierig. Der Krieg hatte große menschliche und gesellschaftliche Wunden hinterlassen. Die tiefsitzenden sozialen und politischen Spaltungen, die den Krieg ausgelöst hatten, bestehen bis heute fort. Obwohl es Fortschritte in der Armutsbekämpfung gab, lebte kurz nach dem Krieg noch immer rund ein Drittel der Bevölkerung in Armut, darunter insbesondere ethnische Minderheiten. Aber Nepal hatte auch Vorteile im Vergleich zu Konfliktländern wie Afghanistan. Dazu gehören frühere Erfahrungen mit Demokratie und ein umfassender, in der Bevölkerung breit akzeptierter Friedensvertrag. Dem Krieg gingen zwei Demokratieexperimente voraus (1959 bis 1961 und 1990 bis 2005), die jeweils abrupt endeten, als das Königshaus die zuvor abgegebene Macht wieder an sich riss. Nach dem königlichen Staatsstreich 2005 bildete sich eine breite zivilgesellschaftliche Bewegung, die im Frühjahr 2006 nicht nur erfolgreich die Rückkehr zur Demokratie forderte, sondern auch den Verhandlungen um den Friedensvertrag neuen Schub gab und ein Partner für die internationale Arbeit im Land wurde.
Schließlich trug das hohe Maß an lokaler Verantwortung unter den Konfliktparteien in Nepals Friedensprozess zu seinem Gelingen bei. Dies untermauert das Argument der Forschung, dass nicht Blaupausen zu Erfolgen in der Friedens- und Sicherheitspolitik führen, sondern Einsätze, die Frieden „von unten“ fördern und auf lokale Erfahrungen und Expertise bauen.
Klar ist, dass die kleine und unbewaffnete UN-Mission die Konfliktparteien nicht hätte aufhalten können, hätten diese wirklich zum Krieg zurückkehren wollen. So wurden etwa die Behälter, in denen die Waffen der maoistischen Kämpfer*innen gesammelt wurden, zwar regelmäßig von mobilen Überwachungsteams besucht, aber nicht kontinuierlich durch die UN bewacht. Mit anderen Worten: Es gab genügend Raum, den Friedensprozess zu unterwandern. Aber die internationale Präsenz in Nepal sollte mehr symbolische Unterstützung als tatsächliche physische Abschreckung bieten. Dass das im Großen und Ganzen funktioniert hat, hat damit zu tun, dass der Grundsatz lokaler Eigenverantwortung schnell der Kern der politischen Kultur wurde, die den Friedensprozess umgab. In Forschungsinterviews nutzten nepalesische Expert*innen immer wieder die Formulierung, dass der Frieden „mit nepalesischer Erfahrung und nepalesischem Wissen“ geschaffen wurde. Denn das hohe Maß an Eigenverantwortung förderte die Zusammenarbeit zwischen den Konfliktparteien, die Misserfolge nicht auf die internationale Gemeinschaft schieben konnten und denen bewusst war, dass Wähler*innen sie für diese Misserfolge verantwortlich machen würden. Rebellenchef Dahal erklärte etwa 2007, hätte er die Wahlen boykottiert, „wären wir Maoisten für das Scheitern des Friedensprozesses verantwortlich gemacht worden. Das wollten wir nicht.“
Was sind die Lehren für die Friedenspolitik „nach Afghanistan“?
Bei allen beträchtlichen Erfolgen zeigen sich in Nepal auch die Grenzen dessen, was in Friedensprozessen realistischerweise erreicht werden kann und welche Abwägungen internationale Friedenspolitik treffen muss: Dafür steht exemplarisch die jüngste Kritik der Menschenrechtsorganisationen an der fehlenden Aufarbeitung der Kriegsverbrechen. Denn die bislang ausgebliebene strafrechtliche Verurteilung ist kein Nebenprodukt, sondern Ergebnis des alternativen Weges, den die internationale Gemeinschaft in Nepal gegangen ist. Dass die Umsetzung des Friedensprozesses maßgeblich in den Händen der Konfliktparteien lag, hat einen bedeutenden Beitrag dazu geleistet, dass die Rebellengruppe ihre Waffen niedergelegt und sich erfolgreich in eine politische Partei verwandelt hat. Gleichzeitig hat dieses Modell dafür gesorgt, dass die politischen Eliten der früheren Konfliktparteien sich bis heute gegenseitig vor Strafverfolgung schützen.
Auch lassen sich die Bausteine von Nepals Friedensprozess nicht eins zu eins auf andere Länder übertragen: Nur weil sie in Nepal funktioniert haben, bedeutet das nicht, dass sie auch in Afghanistan, Mali oder Syrien zum Erfolg führen würden. Genau dies aber verdeutlicht das Beispiel Nepals: Maßgeschneiderte Einsätze anstelle von Blaupausen, realistische Ziele, die an die Ausgangsbedingungen vor Ort geknüpft sind sowie ein hohes Maß an lokaler Eigenverantwortung können wichtige Bausteine für eine erfolgreiche Friedenspolitik in Konfliktländern sein.
Das bedeutet, dass Friedensförderung künftig stärker als in der Vergangenheit von Afghan*innen, Malier*innen oder Syrer*innen entworfen und geleitet sowie von internationalem Personal mit Ortskenntnis unterstützt werden muss. Dafür sollte sich die internationale Gemeinschaft weniger an Fragen wie „Wie lässt sich Afghanistan stabilisieren?“ orientieren und mehr an solchen wie „Was benötigen Afghan*innen, um sich sicher zu fühlen und wie können wir ihnen dabei helfen?“.
Schließlich – das zeigt sich bei allen Unterschieden sowohl in Nepal als auch Afghanistan – gibt es ohne Gerechtigkeit keinen Frieden. Wenn die Aufarbeitung von Kriegsverbrechen zugunsten von „Stabilität“ ignoriert wird, schürt dies Straflosigkeit und Korruption und kann am Ende sogar Ursache neuer Gewalt sein.