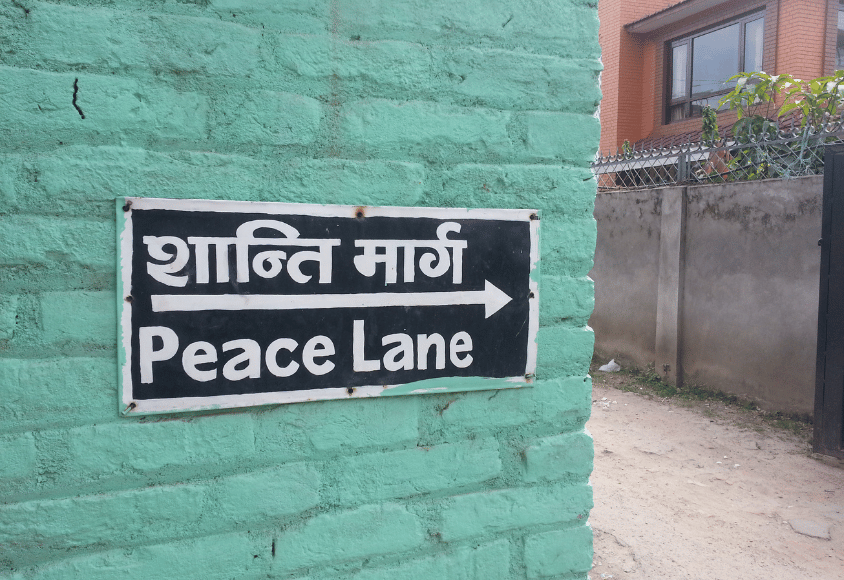Liebe Leser*innen,
gestern vor einem Jahr, am 24. Februar 2022, marschierten russische Truppen großflächig in die Ukraine ein. Dieser völkerrechtswidrig geführte Angriffskrieg hat die europäische Friedens- und Sicherheitsordnung erschüttert. Wie seine Auswirkungen über Europa hinausreichen und Konfliktdynamiken auf der ganzen Welt beeinflussen, beleuchten Julia Strasheim und Raja Albers in unserem Schmidtletter.
Sie sagen: Auch internationale Bemühungen zur Konfliktbewältigung und Friedensförderung werden sich angesichts des Kriegs langfristig verändern. Gemeinsam mit der Friedrich-Ebert-Stiftung gründen wir daher in den nächsten Wochen ein Netzwerk aus Expert*innen der Konfliktbewältigung und Friedensförderung, die selbst aus Konflikt- und Postkonfliktländern stammen. Mit ihnen werden wir Politikempfehlungen für die Bewältigung der globalen Folgen des Kriegs entwickeln.
Wir halten Sie auf dem Laufenden über die Fortschritte dieses Projekts
und wünschen Ihnen ein schönes Wochenende.
Ihre Bundeskanzler-Helmut-Schmidt-Stiftung
Russlands Krieg gegen die Ukraine ist bereits jetzt einer der schlimmsten Gewaltausbrüche auf dem europäischen Kontinent seit 1945 und hat etablierte Grundannahmen deutscher und europäischer Außenpolitik in Frage gestellt. Seine Folgen treffen in erster Linie Menschen in der Ukraine. Zu den russischen Kriegsverbrechen, die Menschenrechtsorganisationen seit dem 24. Februar 2022 dokumentiert haben, gehören Exekutionen, Folter, sexualisierte Gewalt, gezielte Angriffe auf Wohngebiete, Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser und die zivile Wasser- und Stromversorgung sowie der Einsatz besonders brutaler und international geächteter Waffen wie Streumunition oder Antipersonenminen. Schätzungen der Weltbank zufolge ist die Armutsquote der Ukraine – also der Anteil der Menschen, der mit einem Einkommen unterhalb der Armutsgrenze von 5,50 US Dollar am Tag auskommen muss – infolge des Kriegs von 1,8 auf 19,8 Prozent gestiegen. Die Vereinten Nationen (VN) gehen sogar davon aus, dass im weiteren Kriegsverlauf bis zu 90 Prozent der Ukrainer*innen von Armut betroffen sein werden.
Doch auch über die Ukraine hinaus hat der Krieg folgenschwere Konsequenzen – besonders für das globale Konfliktgeschehen.
Multiple Krisen treffen Konflikt- und Postkonfliktländer besonders schwer
Zwar haben auch in Deutschland Sorgen über Inflation, steigende Energiepreise oder Lebensmittelengpässe als Folge des Kriegs zuletzt unseren Alltag dominiert. Jedoch treffen solche Krisen Menschen in Konflikt- und Postkonfliktländern besonders schwer. Diese Länder sind bereits von eigenen Gewaltkonflikten, politischer Instabilität sowie den Folgen der Pandemie und des Klimawandels betroffen. In Syrien kommt mit dem Erdbeben vom 6. Februar 2023 eine der schlimmsten Naturkatastrophen der letzten hundert Jahre hinzu. Die kombinierten Effekte gleichzeitiger und komplexer Krisen verstärken bereits bestehende humanitäre Missstände und machen Fortschritte der menschlichen Entwicklung zunichte.
Das zeigt sich am Beispiel von Jemen. Das Land leidet bereits seit der Eskalation des Bürgerkriegs im Jahr 2015 unter einer gravierenden Nahrungsmittelknappheit. Der Ukrainekrieg hat diese Krise durch den Einbruch des globalen Getreidemarkts und den Anstieg der Nahrungsmittelpreise verschärft. Jemen importiert etwa 95 Prozent seines Weizenbedarfs aus dem Ausland – 30 Prozent davon aus Russland oder der Ukraine. Dieser infolge des Ukrainekriegs nochmal erschwerte Zugang zu lebensnotwendigen Nahrungsmitteln wirkt sich auf die Sicherheit der Menschen vor Ort aus. So ist die Zahl derer im Jemen, die Hunger leiden, laut dem VN-Welternährungsprogramm von gut 16 Millionen Menschen im Jahr 2021 auf 19 Millionen Menschen Ende 2022 angestiegen.
Die Erfahrung zeigt: Diese Krisen können langfristig zur weiteren Eskalation bereits bestehender Konflikte oder zum Ausbruch neuer Kriege beitragen. Kriege gehören zu den Hauptursachen von Hunger und Unterernährung, da Kriegsparteien etwa Ernten zerstören, Vieh töten oder Agrarflächen durch Landminen auf Jahrzehnte unbenutzbar machen. Ein mangelnder Zugang zu Nahrung kann umgekehrt aber auch Ursache für neue Gewalt sein. Die „Brotaufstände“ im Jahr 2008 in Ländern wie Ägypten oder Burkina Faso gelten als Beispiel für diesen Zusammenhang.
Globale und lokale Konfliktdynamiken verändern sich
Erste Schätzungen des Konfliktdatenprogramms der Universität Uppsala zeigen: Der russische Krieg in der Ukraine hat – zusammen mit dem in der deutschen Öffentlichkeit viel weniger beachteten Krieg in Äthiopien – das globale Konfliktgeschehen 2022 zahlenmäßig dominiert. In Äthiopien sind im letzten Jahr etwa 100.000 Menschen durch Kampfhandlungen ums Leben gekommen, in der Ukraine waren es 70.000 Menschen. Damit haben allein diese beiden Kriege 2022 mehr Opfer gefordert als alle Kriege und bewaffneten Konflikte im Vorjahr zusammen: 2021 starben weltweit 119.000 Menschen durch Kämpfe.
Nicht nur global betrachtet werden die Auswirkungen von Russlands Angriffskrieg sichtbar. Der Krieg verändert auch lokale Konfliktdynamiken in anderen Weltregionen. In Syrien können taktische Veränderungen in Russlands Militärpräsenz – zum Beispiel durch die Verlegung von Truppen oder Luftverteidigungssystemen – regionalen Mächten wie dem Iran oder der Türkei ermöglichen, ihren politischen Einfluss auszubauen. Ein Machtvakuum kann auch durch nichtstaatliche Akteure gefüllt werden, darunter private Militärunternehmen. Nichtregierungsorganisationen haben zum Beispiel dokumentiert, dass die Zahl der in Mali eingesetzten Söldner der russischen Wagner-Gruppe im Jahr 2022 drastisch angestiegen ist – genauso wie gravierende Menschenrechtsverletzungen. Auch im Sudan und in der Zentralafrikanischen Republik ist die Wagner-Gruppe aktiv und zunehmend an lukrativen Gewinnen aus dem Rohstoffhandel – nicht zuletzt bei der Förderung von Gold oder Diamanten – beteiligt.
Das heißt nicht zwingend, dass Russland mithilfe der Gewinne aus anderen Konfliktregionen den Krieg in der Ukraine finanziert. Die Erträge können den russischen Staat aber inmitten westlicher Sanktionen stützen. Zudem können sich durch den Rohstoffhandel die Finanzierungsquellen für Kampfhandlungen in Konfliktländern selbst verändern. Das kann das Eskalationsrisiko für bereits bestehende Konflikte erhöhen, etwa indem private Militärunternehmen Rebellengruppen oder Militärs als Gegenleistung für Rohstoffe mit Waffen versorgen.
Wie in Zukunft Konflikte bewältigt und Frieden gesichert werden können
Schließlich hat Russlands Krieg gegen die Ukraine das Potenzial, internationale Strategien der Konfliktbewältigung und Friedensförderung langfristig zu verändern. Denn das russische Vorgehen hat nicht nur jahrzehntealte Rufe nach einer Reform der Vereinten Nationen und ihres Sicherheitsrats verstärkt und die Unzufriedenheit von Staaten des „Globalen Südens“ über moralische Doppelstandards westlicher Länder verdeutlicht. Expert*innen erwarten vielmehr, dass Russlands Krieg die bestehende Krise des „liberalen Interventionismus“ weiter verschärft. Damit ist das Standardrezept multilateraler Friedenseinsätze gemeint, mit dem seit Anfang der 1990er-Jahre in Ländern wie Bosnien, Afghanistan oder Liberia versucht wurde, durch demokratische und marktwirtschaftliche Reformen Kriege dauerhaft zu beenden und nachhaltigen Frieden zu fördern.
Nicht erst seit dem Fall von Kabul im August 2021 hat die Ernüchterung über die geringen Erfolge dieser ehrgeizigen Friedenseinsätze dazu beigetragen, dass internationale Interventionen zuletzt verstärkt auf Ziele wie Stabilisierung und Terrorismusbekämpfung gesetzt haben. Der letzte neue VN-Friedenseinsatz wurde 2014 beschlossen. Die internationale Demokratieförderung in Postkonfliktländern befindet sich im Abwärtstrend. Und autoritäre Staaten wie China bringen sich immer aktiver in die internationale Konfliktbewältigung ein, setzen dabei jedoch auf Armutsbekämpfung und Infrastrukturausbau und nicht auf demokratische Reformen.
Nimmt das Vertrauen in internationale Strategien zur Konfliktbewältigung und Friedensförderung also seit Jahren ab, so hat Russlands Krieg es weiter geschmälert. Expert*innen vermuten, dass die Stärkung eigener militärischer Fähigkeiten in Europa das weltweite Engagement für Konfliktbewältigung nachhaltig beeinträchtigen wird, und bezweifeln, dass die VN künftig noch ein Mandat für robuste Friedenseinsätze erhalten. Als Konsequenz könnten sie in Zukunft stärker auf humanitäre Bemühungen setzen. Das ist wichtig, bleibt aber weit hinter nachhaltigen Konfliktlösungsstrategien zurück, für die es neben kontextspezifischen Maßnahmen auch effektive multilaterale Mechanismen braucht.
Wie könnte das aussehen? Um dieser Frage nachzugehen, gründet die Bundeskanzler-Helmut-Schmidt-Stiftung in diesem Jahr gemeinsam mit der Friedrich-Ebert-Stiftung ein Netzwerk an Expert*innen aus Konflikt- und Postkonfliktländern, um die Auswirkungen des russischen Angriffskriegs auf Konfliktdynamiken weltweit zu analysieren und Politikempfehlungen für die Bewältigung der globalen Folgen des Kriegs zu entwickeln. Den Kern des Projektes bilden also die Expertise von Menschen aus Konfliktkontexten, die erfahrungsbasiertes Wissen über erfolgsversprechende Maßnahmen zur Konfliktbewältigung und Friedensförderung mitbringen.